Habecks Milliarden-Coup
"Das ist ein Trump'sches Narrativ"

Robert Habeck (r.) und sein australischer Kollege Chris Bowen: Deutschland und Australien haben große gemeinsame Wasserstoff-Pläne. (Quelle: imago images/Collage: Heike Aßmann)
Robert Habecks Ministerium vergibt Milliarden, um den globalen Wasserstoffmarkt anzukurbeln. Die Pläne lösen gemischte Reaktionen aus.
Aus Brisbane berichtet Anna-Lena Janzen
Die Bundesregierung stellt Milliarden an Förderung bereit, um den Wasserstoffmarkt in Schwung zu bringen. Nun will sie auch einen Partner in Übersee ins Boot holen. Schon im Sommer vergangenen Jahres flatterte dazu ein Schreiben von Wirtschaftsminister Robert Habeck bei seinem australischen Amtskollegen Chris Bowen ein. Es handle sich um ein Projekt, in das Deutschland und Australien je rund 200 Millionen Euro investieren sollen, bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums.
Der Hintergrund für Habecks Vorstoß: Die Bundesregierung sieht "grünen" Wasserstoff als einen Schlüssel für die Energiewende. Bis zu 70 Prozent des klimaneutralen Kraftstoffs, mit dem die Bundesregierung bis 2030 plant, soll aus dem Ausland importiert werden. Dabei soll Australien eine bedeutende Rolle spielen. Die Bundesregierung will gemeinsam mit Partnern Anreize für Investitionen in klimafreundliche Technologien schaffen. Es gibt allerdings Zweifel, ob Deutschlands ambitionierte Wasserstoffziele überhaupt erreicht werden können.
"Wir stehen ganz am Anfang", sagte Energieökonomin Claudia Kemfert im Mai bei einem Vortrag für das "Netzwerk Klimajournalismus" zum Thema Wasserstoff. Die Fördermilliarden der Regierung für den Markt sind der Expertin zufolge sinnvoll und wichtig. Dennoch: "Der Turbo muss vor allem beim Ausbau der erneuerbaren Energien stattfinden". Andernfalls könnten die Klimaziele in Gefahr geraten, so die Leiterin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).
Auch bei einem möglichen Import aus Übersee handle es sich um ein Zukunftsszenario, so Kemfert auf Nachfrage von t-online. "Wir sprechen von einem Zeitraum ab 2035, wo man Wasserstoff haben wird und man diesen importieren kann". Kemfert bezweifelt zudem, dass neue LNG-Terminals, die gebaut wurden, um sich vom russischen Pipeline-Erdgas unabhängig zu machen, problemlos auf grünen Wasserstoff umgestellt werden können. Das sei noch nicht erprobt, sagte die Leiterin des DIW.
"Grüner" Wasserstoff: Energieträger der Zukunft?
"Grüner" Wasserstoff wird durch die Elektrolyse von Wasser hergestellt. Dabei wird das Wasser mithilfe von elektrischem Strom in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) zerlegt. Das Verfahren gilt nur dann als klimaneutral, wenn der Strom dafür aus erneuerbaren Energien wie Wind oder Sonne stammt. Doch die Herstellung "grüner" Kraftstoffe verbraucht viel Energie, daher ist der nachhaltige Wasserstoff knapp und teuer. Experten sind sich daher einig: Er sollte nur da zum Einsatz kommen, wo es keine direkte elektrische Alternative gibt wie etwa in der Industrie oder dem Schiffs- und Flugverkehr.
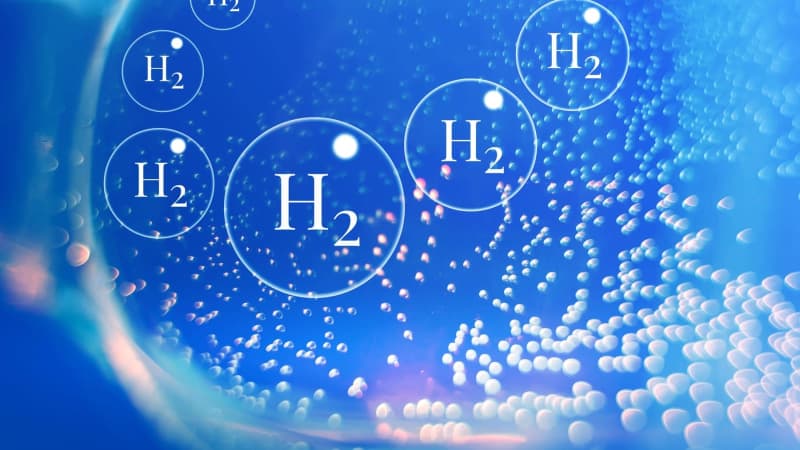
(Quelle: IMAGO/Piero Nigro)
"Das ist ein Trump'sches Narrativ"
Ein führender Experte aus Australien zweifelt im Gespräch mit t-online gänzlich an der Rentabilität von "grünem" Wasserstoff für Länder wie Deutschland, die selbst nur wenig Ressourcen für eine eigene Produktion haben. "Wenn man Wasserstoff verwendet, muss man ihn dort einsetzen, wo man ihn herstellt", so Professor Peter Newman von der Curtin University in Perth. Alles andere sei nicht wirtschaftlich. Der gesamte Prozess der Erzeugung grüner Metalle und Mineralien werde daher wahrscheinlich dort stattfinden, wo man den Wasserstoff billig und direkt herstellen kann.
Statt Geld und Energie in den Bau neuer Gasanlagen zu investieren, sollten Regierungen sich auf den Ausbau von erneuerbaren Energien fokussieren, so Newman: Wind und Sonne seien die sichersten Formen von Energie. "Die Idee, dass eine LNG-Anlage Wasserstoff annehmen wird, ist ein Trump'sches Narrativ. Wenn man es laut und lange und immer wieder sagt, kann man eine ganze Menge Leute überzeugen. Aber in Wirklichkeit gibt es dafür keine Grundlage", sagt der Wissenschaftler, der bereits drei Gutachten für das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) verfasst hat.
Auch laut neuen Rechercheergebnissen des Netzwerks "Correctiv" steht es um die Fähigkeit deutscher Kraftwerke, Wasserstoff einzusetzen, nicht annähernd so gut, wie es häufig in den Medien dargestellt wird. "Die Wasserstoff-Republik ist bislang noch ein Wunschtraum", ist in dem Bericht zu lesen. Der Energieträger werde von der Regierung und Industrien als künftiges Allheilmittel gehandelt. Dahinter stecke auch die Erdgasindustrie, die mit neuen Gasterminals weiter Geschäfte machen wolle. Ob und wann Wasserstoff jedoch tatsächlich verfügbar, bezahlbar und transportierbar sein werde, das wisse bislang noch niemand.
"Riesige Lücke zwischen Ankündigungen und Umsetzung"
"Deutschland hinkt seinen Plänen deutlich hinterher", heißt es auch in einer aktuellen Studie von Pricewaterhouse Coopers (PwC). Weniger als 0,1 Prozent der Wasserstoffherstellung, die die deutsche Bundesregierung plant, laufen aktuell schon. Um das Ziel von zehn Gigawatt (GW) bis 2030 noch zu erreichen, müsste Deutschland jedes Jahr Elektrolyseanlagen (siehe Infokasten) mit 1 bis 2 GW und 200 bis 400 Windräder bauen, schrieben die Branchenexperten in ihrem Bericht.
Und nicht nur Deutschland ist mit seiner Strategie offenbar ein Wagnis eingegangen: "Weltweit klafft eine riesige Lücke zwischen den Ankündigungen und der Umsetzung", heißt es in der Studie von PwC. Viele Projekte existieren demnach nur auf dem Papier, haben aber keine finalen Zusagen für Finanzierungen. "Der kapitalintensive Wasserstoffmarkt steckt weiterhin in den Kinderschuhen", schreibt Co-Autor Dirk Niemeier. Die größte Barriere sei das Fehlen großvolumiger Abnahmeverträge, was die Finanzierung und damit Fertigstellung der Produktionsprojekte verhindere.
Australien etwa bietet zwar beste Bedingungen für die Produktion nachhaltiger Kraftstoffe (Wind, Sonne und Landfläche) und verfügt über ausreichend Erfahrung als Energieexportnation. Dennoch muss auch hier deutlich mehr in die neuen Technologien investiert werden, bevor der Wasserstoff aus dem Land am anderen Ende der Welt im großen Stil nach Europa exportiert werden kann.
Bislang kann weltweit nur ein Schiff verflüssigtes H2 transportieren
Dafür braucht es nicht nur ausreichende Herstellungs-, sondern auch Transportkapazitäten. Bislang kann weltweit nur ein Schiff flüssigen Wasserstoff transportieren: die "Suiso Frontier" (siehe Infokasten). Australiens größter in Betrieb befindlicher Elektrolyseur, der Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spaltet, hat zudem aktuell eine Leistung von nur 1,25 Megawatt. Das entspricht etwa der Energie, die 1.250 Wasserkocher in derselben Zeitspanne erzeugen würden. Eine beeindruckende Leistung, aber wohl nicht ausreichend für die umfangreichen Zukunftspläne des Landes.
Wie funktioniert der Transport von Wasserstoff?
Wasserstoff kann über weite Strecken nicht als Gas transportiert werden. Um ihn für den Transport in Schiffstankern vorzubereiten, muss er entweder verflüssigt oder in ein Trägermedium wie Ammoniak oder Methanol umgewandelt werden. Dazu muss er auf minus 33 Grad gekühlt werden. Diese Flüssigkeit lässt sich dann in Stahltanks verhältnismäßig einfach und sicher transportieren. Aus Ammoniak etwa kann dann später in Deutschland wieder Wasserstoff gewonnen werden. Allein der Schiffsverkehr ist für 2,6 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich: Damit die Tanker CO2-arm fahren, muss auch eine Lösung her.

"Suiso Frontier": Das Schiff gehört zu einem Pilotprojekt zwischen Australien und Japan. (Quelle: IMAGO/via www.imago-images.de/imago)
Auch daher will die Bundesregierung nun wohl weltweite Anreize für die Industrie schaffen, um Innovation und Investitionen rasch voranzutreiben. Habecks Ministerium hat als Erstes in Europa auf ein Auktionsmodell gesetzt, um die hohen Preise für Wasserstoff auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger zu machen. Für den Mechanismus der H2-Global-Stiftung, dessen Gründungsmitglieder Dutzende Unternehmen wie Siemens Energy, Thyssenkrupp und der Erdgasriese Uniper sind, hat Deutschland bereits 900 Millionen Euro für ein erstes Förderfenster bereitgestellt. Dem Wirtschaftsministerium zufolge werden derzeit weitere Ausschreibungen mit einem Volumen von bis zu 3,5 Milliarden Euro vorbereitet. Jetzt hofft man, dass auch Australien sich mit einer Finanzspritze beteiligt.
Australien erwägt eine Beteiligung am deutschen Mechanismus
Der Mechanismus, an dem die Regierung in Canberra sich beteiligen soll, funktioniert folgendermaßen: Es gibt eine Auktion für Hersteller im Partnerland, bei der das beste Angebot einen langfristigen Liefervertrag und somit die notwendige Planungssicherheit für Investitionen bekommt. Die klimaneutralen Stoffe müssen dann nach Europa transportiert werden, wo sie erneut an potenzielle Abnehmer auktioniert werden. Die Fördergelder der Regierungen sollen die Schere zwischen dem hohen Angebot und niedrigen Nachfragepreis auf dem derzeitigen Markt ausgleichen.
"Mit H2Global soll die grüne Transformation unserer Gesellschaft und Wirtschaft marktwirtschaftlich gefördert und beschleunigt werden", sagt eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. Die Umsetzung und Weiterentwicklung von H2Global erfolgt durch die gemeinnützige Stiftung H2Global, deren Tochtergesellschaft Hint.Co GmbH die bereitgestellten Mittel zum Ausgleich der Differenz zwischen Angebots- und Nachfragepreisen einsetzt. Die Verkündung der Ergebnisse einer ersten Auktion stehe jetzt zeitnah an, so die Sprecherin.
Machbarkeitsstudie zu Lieferketten kommt zu positivem Ergebnis
Dann wird sich wohl auch herausstellen, ob Australien sich an einer Auktion mit Deutschland beteiligt. Die beiden Länder haben bereits mehr als 70 Millionen Euro für gemeinsame Forschungsprojekte in dem Feld ausgegeben. Eine Machbarkeitsstudie beider Länder für eine Lieferkette der nachhaltigen Kraftstoffe nach Europa soll positiv ausgefallen sein. Gut drei Jahre lang untersuchte das Projekt "HySupply" mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), ob und wie der Import von erneuerbarem Wasserstoff aus Australien gelingen kann.
Die Studie wurde im Juni 2022 veröffentlicht und kommt zu dem Ergebnis, dass die Errichtung von Importinfrastrukturen für Wasserstoff rechtlich möglich sei, aber die Umsetzung komplex und zeitintensiv sein könne. Für die neu zu entwickelnden Märkte für "grünen" Wasserstoff sollen die Transportkosten im Wasserstoff-Handel mit Australien den Studienergebnissen zufolge einen Anteil von 5 bis 11 Prozent haben.
Eine Sprecherin des australischen Ministers für Klima und Energie, Chris Bowen, bestätigte t-online: Man arbeite mit den deutschen Partnern, um den H2-Global-Mechanismus besser zu verstehen. Entscheidungen wolle man aber erst nach den Ergebnissen der ersten Auktionsrunden treffen. Habecks Ministerium sprach von "positiven Signalen" seitens der australischen Regierung.
Diese hat derweil auch eigene große Pläne und will sich als zukünftige "renewable energy superpower" (Supermacht für erneuerbare Energien) aufstellen. Die Entwicklung von "grünem" Wasserstoff ist eine Schlüsselkomponente des diesjährigen Budgets. Erst im Mai stellte die Regierung ihren neuen Haushalt im Parlament vor, worin rund 14 Milliarden Euro für das "Future Made in Australia"-Paket vorgesehen sind. Darunter fallen auch Subventionen für "grünen" Wasserstoff, darunter steuerliche Anreize im Wert von 6,7 Milliarden australischen Dollar (rund 4 Milliarden Euro), um die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff zu fördern.
Verwendete Quellen:
- Gespräch mit Professor Peter Newman
- Anfrage an die australischen und deutschen Ministerien
- Anfrage an H2Global und h2-global.de
- Klima-Briefing vom "Netzwerk Klimajournalismus" mit Claudia Kemfert
- bdi.eu: HySupply
- afr.com.au: Germany's $660m pitch for Australia's green hydrogen (englisch)
- bmbf.de: HyGATE–Informationen zur Wasserstoffkooperation von Deutschland und AustralienFAQ
- bmwk-energiewende.de: Was ist eigentlich H2 Global?
- dcceew.com.au: Australia’s National Hydrogen Strategy (englisch)
- hydrogeninsight.com: H2Global floats timeframe to announce winners of massive €900m hydrogen auctions — and confirms extra funding (englisch)
- hydrogeninsight.com: Canada joins German hydrogen import auction scheme H2Global, but funding details not yet disclosed (englisch)
- correctiv.org: Der Wasserstoff-Bluff
- diw.de: Energie-Ziele der Ampel-Koalition – und wo wir heute stehen
- ise.fraunhofer.de: Metastudie Wasserstoff – Auswertung von Energiesystemstudien
- offshore-energy.biz: The Netherlands and Germany bolster hydrogen ties (englisch)
- Mit Material von dpa
